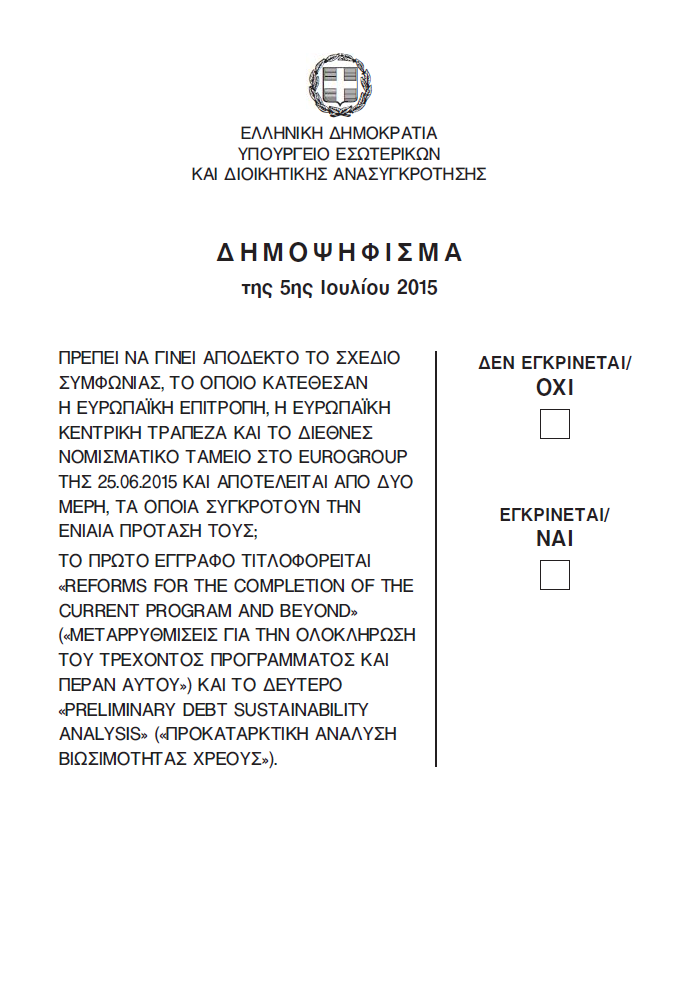- Die Debatte, wie der nächste UN-Generalsekretär gewählt werden soll, ist in vollem Gange. Wo stehen die Mitgliedstaaten?
Noch
gut ein Jahr, dann ist es wieder einmal so weit – 2016 wird der
neue UN-Generalsekretär gewählt. Es ist das höchstrangige Amt, das
die Weltgemeinschaft zu vergeben hat, und zugleich eines mit sehr
besonderem Charakter: Es verbindet geringe formale Macht mit einem
enormen politischen Einfluss. Umso wichtiger für seine Ausgestaltung
ist die Persönlichkeit des Amtsträgers selbst. Während einige
frühere Generalsekretäre wie Dag Hammarskjöld (1953-61) oder Kofi
Annan (1997-2006) wichtige weltpolitische Veränderungen anstießen,
blieben andere wie Kurt Waldheim (1972-81) oder Ban Ki-moon (seit
2007) eher passiv und farblos. Bei der Wahl im kommenden Jahr geht es also nicht nur darum, wer künftig den Beamtenapparat am East River leitet, sondern auch darum, welche Rolle die UNO in den nächsten Jahren spielt.
Forderungen
nach einem besseren Wahlverfahren
Wie
aber findet man den besten UN-Chef? Bislang lief das Verfahren stets
so, dass der UN-Sicherheitsrat einen Kandidaten nominierte, der dann
von der Generalversammlung mit Zweidrittelmehrheit ernannt wurde. Für
den Nominierungsprozess selbst gibt es jedoch keine formellen Regeln
– außer dass die fünf ständigen Sicherheitsratsmitglieder (USA,
Russland, China, Frankreich und Großbritannien) dabei ein Vetorecht
haben. Das Verfahren ist also nicht nur überaus intransparent,
sondern ballt auch sehr viel Macht bei sehr wenigen Staaten.
Da
das für den Rest der Welt natürlich frustrierend ist und auch die
Legitimität des Generalsekretärs selbst beschädigt, wurden zuletzt
immer wieder Forderungen nach einem neuen Ernennungsverfahren laut,
über die ich bereits in
einem früheren Artikel auf diesem Blog berichtet habe.
Vorgeschlagen wurden unter anderem:
● ein klarer Zeitplan und eine öffentliche Bekanntgabe der Kandidaten,
die sich auf das Amt bewerben,
● öffentliche Anhörungen der Kandidaten vor der Generalversammlung
und dem Sicherheitsrat,
● die Nominierung von zwei oder mehr Kandidaten durch den
Sicherheitsrat, sodass die Generalversammlung eine Auswahl zwischen
ihnen treffen kann,
● die Begrenzung der Amtszeit des Generalsekretärs auf eine
Wahlperiode, um ihn von den Mitgliedstaaten unabhängiger zu machen.
Darüber
hinaus gibt es auch noch spezifischere Wünsche an das Profil des
neuen Generalsekretärs. Zum einen ist die Forderung weit verbreitet,
dass nach acht Männern nun erstmals auch eine Frau für das Amt
ernannt wird. Zum anderen ist es in den Vereinten Nationen üblich,
dass wichtige Posten zwischen den verschiedenen Weltregionen rotieren
– und da Osteuropa als einzige regionale
Gruppe noch niemals den Generalsekretär gestellt hat, wäre nun
ein osteuropäischer Kandidat an der Reihe. Welche Namen dabei in
Frage kämen, habe ich hier ebenfalls schon
in einem früheren Artikel behandelt.
Von
der Zivilgesellschaft zu den offiziellen UN-Gremien
Träger
diese Reformforderungen waren zunächst vor allem
zivilgesellschaftliche Akteure. So wurde die Debatte über das
Wahlverfahren vor allem durch die Kampagne 1for7billion vorangetrieben, hinter der insbesondere das
World Federalist Movement, die
britische United Nations Association
UK, das Netzwerk Avaaz
sowie das New
Yorker Büro der deutschen Friedrich-Ebert-Stiftung stehen.
Daneben machen sich auch The
Elders, eine
einst von Nelson Mandela ins
Leben gerufene und nun von
Kofi Annan geleitete Gruppe
ehemaliger Spitzenpolitiker,
für ganz
ähnliche Reformen stark. Für
die Ernennung einer
weiblichen Generalsekretärin schließlich gibt es eine eigenständige
Campaign to Elect a Woman
UNSG.
Seit
einigen Monaten hat die Debatte jedoch den Raum des bloßen
zivilgesellschaftlichen Aktivismus verlassen und auch die offiziellen
Gremien der Vereinten Nationen erreicht. So diskutierte im März und
April die Ad
Hoc Working Group on the revitalization of the work of the General
Assembly (eine
Arbeitsgruppe der
Generalversammlung)
in mehreren Sitzungen
über das Wahlverfahren des
Generalsekretärs. Und am
vergangenen Mittwoch erreichte sie schließlich erstmals
auch den UN-Sicherheitsrat.
Machtverschiebung vom Sicherheitsrat zur Generalversammlung
Dass
die Debatte auf diese Weise den politischen Raum erreicht, zwingt
die nationalen Regierungen dazu, sich zu positionieren,
und ermöglicht dadurch auch
der Öffentlichkeit ein klareres Bild. Wie
stehen die einzelnen
UN-Mitgliedstaaten zu den Vorschlägen für ein transparenteres und
inklusiveres Wahlverfahren des Generalsekretärs? Welche
Länder und Ländergruppen
nehmen bei der Reform eine
Führungsrolle ein, welche bremsen?
Auf
dem
Blog Global Memo,
das die Ernennungsverfahren
von UN-Spitzenbeamten in den Blick nimmt, findet sich seit einigen
Tagen eine
detaillierte
Übersicht über die
Positionen sämtlicher nationalen Regierungen,
die bereits zu dem Thema
Stellung bezogen haben. (Update: Inzwischen findet sich eine ähnliche Übersicht auch auf der Website von 1for7billion selbst.)
Generell ist
der Frontverlauf dabei klar: Die
Reformvorschläge
für das Wahlverfahren
des Generalsekretärs
würden vor
allem den Spielraum der Vetomächte im Sicherheitsrat reduzieren und
einen Teil seiner politischen Macht auf die Generalversammlung
verlagern. Wenig überraschend
geht die größte Unterstützung für die Reform deshalb von den
Regierungen kleinerer und mittlerer Mitgliedstaaten aus, die am
stärksten durch die Machtkonzentration bei den Großmächten
benachteiligt sind.
ACT-Gruppe:
mehr Transparenz im Verfahren
Eine
Führungsrolle übernimmt dabei die sogenannte
ACT-Gruppe,
die 2013 auf Initiative der
Schweizer Regierung gegründet wurde und derzeit 27 kleine
und mittelgroße Staaten auf verschiedenen Kontinenten (allerdings
fast zur Hälfte aus Europa) umfasst. Ihr
Ziel ist eine Reform
der Arbeitsweise des UN-Sicherheitsrats, um
mehr Transparenz zu schaffen
und die Ausübung von Vetorechten zu reduzieren. Entsprechend
steht der Name der Gruppe als
Kürzel für „Accountability,
Coherence, Transparency“ – Verantwortlichkeit, Kohärenz,
Transparenz.
Was
die Wahl des UN-Generalsekretärs betrifft, unterstützt die
ACT-Gruppe zentrale Forderungen der 1for7billion-Kampagne.
Anfang Juni veröffentlichte sie einen Vorschlag,
in dem sie sich unter anderem für ein nachvollziehbares
Nominierungsverfahren mit festen Fristen, einer öffentlichen
Vorstellung der Kandidaten vor der Generalversammlung sowie
informellen, nicht-öffentlichen Anhörungen im Sicherheitsrat
einsetzt.
Die
Blockfreien: Auswahl für die Generalversammlung
Ebenfalls
eine prominente Rolle spielt zudem die Bewegung
der blockfreien Staaten. Dieses im Kalten Krieg entstandene
Bündnis umfasst Entwicklungs- und Schwellenländer in fast ganz
Afrika, Süd- und Südostasien sowie große Teile Lateinamerikas.
Insgesamt gehören ihm 120 Mitglieder an, fast zwei Drittel der
gesamten Vereinten Nationen.
Bei
einheitlicher Abstimmungsweise könnten die Blockfreien also die
UN-Generalversammlung dominieren, während sie im Sicherheitsrat
derzeit nur eine Minderheit der Mitglieder stellen. Dementsprechend
legen sie noch mehr als die ACT-Gruppe Wert darauf, die eigentliche
Entscheidung in die Generalversammlung zu verlagern, und fordern,
der Sicherheitsrat solle mehrere Kandidaten nominieren, unter
denen die Generalversammlung eine Auswahl treffen kann.
Gruppen
für eine Frau und für Osteuropa
Darüber
hinaus gibt es noch die Group
of Friends in favor of a Woman for Secretary-General of the United
Nations, in der sich 42 Regierungen für eine weibliche
Kandidatin stark machen. Die Gruppe wurde von Kolumbien initiiert und
umfasst neben zahlreichen lateinamerikanischen Staaten auch einige
ökonomische und demografische Schwergewichte wie Deutschland, Japan
oder Pakistan. Kein Mitglied der Gruppe, aber ebenfalls ausdrücklich
für die Ernennung einer weiblichen Kandidatin sind zudem Frankreich
und Großbritannien.
Und
natürlich ist auch die osteuropäische Regionalgruppe aktiv, die
Ende 2014 das Amt sehr
entschieden für sich reklamierte. Unterstützung findet sie
dabei unter anderem bei Brasilien und Deutschland. Und auch die
ACT-Gruppe, die blockfreien Staaten und verschiedene andere
Regierungen sprechen sich generell dafür aus, bei der Ernennung auf
Geschlechtergleichheit zu achten und das Prinzip der regionalen
Rotation beizubehalten – was dafür spräche, für die Nachfolge
von Ban Ki-moon eine Frau aus Osteuropa zu wählen.
Die
fünf Vetomächte
Wie
aber positionieren sich die fünf Vetomächte im UN-Sicherheitsrat,
die das Ernennungsverfahren des Generalsekretärs bisher dominiert
haben? Wie zu erwarten ist, hält sich die Begeisterung über die
Reformvorschläge hier in engen Grenzen. Bemerkenswert aufgeschlossen
zeigt sich nur die britische Regierung, die ein transparentes
Verfahren mit öffentlichen Anhörungen und einem klaren Zeitplan
unterstützt und damit recht nahe an der ACT-Gruppe steht. Auch das
regionale Rotationsprinzip möchte Großbritannien beenden: Wenn die
Osteuropäer das Amt haben wollten, liege es an ihnen selbst, den
„besten Kandidaten“ dafür zu präsentieren.
Allerdings
ist Großbritannien dagegen, der Generalversammlung mehrere
Kandidaten vorzuschlagen, wie es die blockfreien Staaten fordern: Die
eigentliche Entscheidung soll nach wie vor im Sicherheitsrat
erfolgen. Eine ähnlich defensive Haltung nimmt auch Frankreich ein,
das offenbar befürchtet, die Nominierung mehrerer Kandidaten könnte
zu Konflikten zwischen den Regionalgruppen in der Generalversammlung
führen.
Mehr
oder weniger offen ablehnend positionieren sich schließlich die
drei übrigen Vetomächte China, Russland und USA. Vor allem für
die beiden Letzteren gehen schon die Forderungen nach öffentlichen
Anhörungen oder einem festen Zeitplan für die Ernennung des
Generalsekretärs zu weit. Stattdessen beharren sie auf dem Status
quo, der ihnen selbst den größten Einfluss auf die
Kandidatenauswahl gibt.
Vetomächte können nicht allein gegen den Rest der Welt agieren
Und
wie geht es nun weiter? Die Erfahrung mit früheren
UN-Reformvorschlägen lässt wenig Optimismus zu: Am Ende verteidigen
meist die Vetomächte ihre Interessen. Allerdings braucht der
Generalsekretär für seine Wahl eben auch eine Zweidrittelmehrheit
in der Generalversammlung. Völlig ignorieren können die USA und
Russland die anderen Mitgliedstaaten also nicht. Falls der
Sicherheitsrat zuletzt tatsächlich nur einen einzelnen Kandidaten
nominiert und das womöglich auch noch ein Mann ist, könnte dieser
an den Stimmen der Blockfreien scheitern.
Zudem
können auf die Dauer auch die Großmächte kein Interesse daran
haben, in solchen zentralen institutionellen Fragen gegen den
kompletten Rest der Welt zu agieren. Sie delegitimieren damit ja
nicht nur die Vereinten Nationen als Organisation, sondern machen
auch sich selbst unbeliebt. Weiterhin dürfte deshalb viel davon
abhängen, wie viel Druck gerade die mittelgroßen Industrie- und
Schwellenländer aufbauen, auf deren diplomatische Unterstützung die
Vetomächte in anderen wichtigen weltpolitischen Verfahren angewiesen
sind.
Die
großen EU-Länder wie Deutschland bleiben passiv
Tatsächlich
sind einige wichtige Schwellenländer wie Indien oder Südafrika ohnehin führende Mitglieder in der
Blockfreien-Bewegung; andere wie Chile und Saudi-Arabien gehören
auch der ACT-Gruppe an. Mehrere größere aufstrebende Staaten sind
zudem auch auf eigene Faust besonders aktiv: So wollen Indonesien und
Mexiko das Vetorecht im Sicherheitsrat abschaffen, wenn dieser über
die Nominierung von Amtsträgern abstimmt, und Brasilien macht sich
dafür stark, die Amtszeit des Generalsekretär auf eine Wahlperiode
zu begrenzen.
Umso
enttäuschender ist freilich, wie wenig die EU-Mitgliedstaaten
ihren diplomatischen Einfluss in dieser Sache bislang zur Geltung bringen – sieht man einmal von zehn
kleineren Ländern (darunter Österreich) ab, die in der ACT-Gruppe
aktiv sind. Die größeren Staaten hingegen blieben bis auf Großbritannien und
Frankreich bislang völlig passiv: Die deutsche Bundesregierung etwa unterstützt
zwar die Kandidatur einer osteuropäischen Frau, bezieht aber
keinerlei Stellung zur Reform des Verfahrens.
Woher
kommt die deutsche Gleichgültigkeit?
Woher
kommt diese Gleichgültigkeit? Ein Grund mag sein, dass Deutschland
nach wie vor anstrebt, eines Tages selbst
einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat zu übernehmen – was
ohne die Unterstützung der USA und Russlands nicht möglich sein
wird. Gerade im Vergleich mit Großbritannien ist die Bundesregierung
in dieser Frage aber auch kaum Druck aus der Öffentlichkeit
ausgesetzt: Zum einen berichten englischsprachige Medien wie der
Guardian deutlich
häufiger
als
deutsche
über das Ernennungsverfahren des UN-Generalsekretärs. Zum anderen
ist in Großbritannien auch die Zivilgesellschaft aktiver:
Während die United
Nations Association UK zu den Initiatoren der 1for7billion-Kampagne gehört,
findet man auf der Homepage ihres deutschen Pendants, der Deutschen
Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN), nicht einmal
Informationen zu dem Thema.
Und
damit kehrt die Debatte aus den offiziellen Gremien der Vereinten
Nationen zuletzt wieder zu uns Bürgern zurück. 2016 wird der neue
UN-Generalsekretär gewählt, das höchstrangige Amt, das die
Weltgemeinschaft zu vergeben hat, und die halbe Welt ruft nach einer
institutionellen Reform, um die Entscheidung darüber transparenter und
inklusiver zu machen. Es liegt an uns selbst zu entscheiden, ob wir das wichtig finden.
Bild: By David Ohmer [CC BY 2.0], via Flickr.