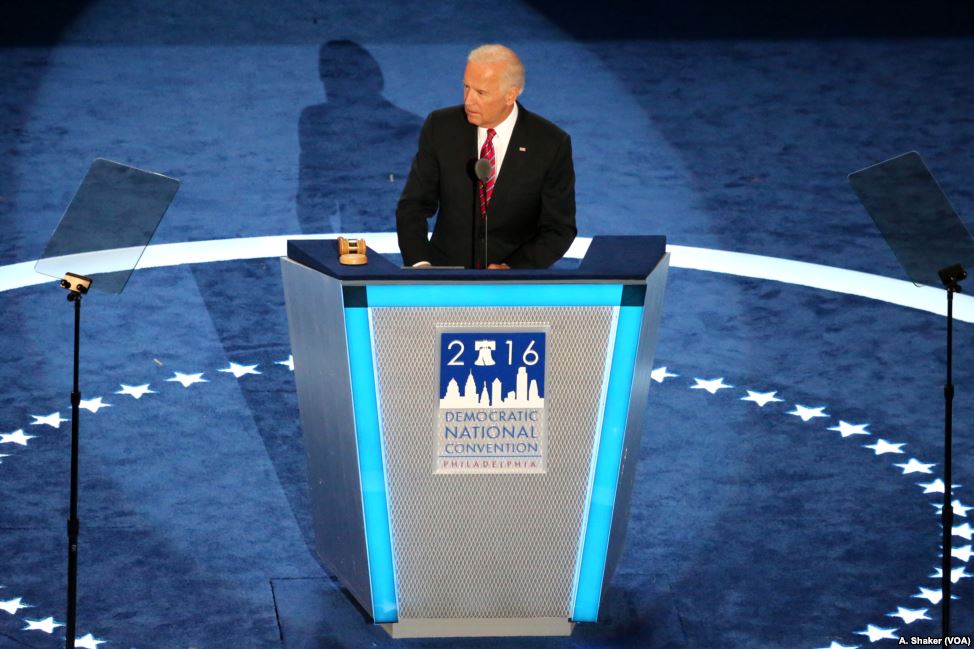Ein europäischer Gipfel ohne Angela Merkel (CDU/EVP), das sei wie Paris ohne den Eiffelturm, erklärte Ratspräsident Charles Michel (MR/ALDE) im vergangenen Oktober. Doch was vor wenigen Monaten noch so ungewohnt schien, wird im neuen Jahr zur Routine werden: Seit Dezember 2021 wird der größte Mitgliedstaat im Europäischen Rat durch Olaf Scholz (SPD/SPE) repräsentiert, dessen Ampelkoalition sich in der Europapolitik große Ziele gesteckt hat.
Und die neue deutsche Bundesregierung ist bei weitem nicht das einzige, was die EU im Jahr 2022 erwartet.
Französisches Semester
In der ersten Jahreshälfte werden sich erst einmal alle Augen auf Frankreich richten. Zum einen hat dessen Regierung die rotierende EU-Ratspräsidentschaft inne, die Präsident Emmanuel Macron (LREM/ALDE-nah) nutzen will, um seine Vision eines „souveränen Europa“ weiter voranzutreiben. Mit Frankreich beginnt auch eine neue Triopräsidentschaft, die in der zweiten Jahreshälfte mit Tschechien und in der ersten Hälfte 2023 mit Schweden fortgesetzt wird.
Zum anderen findet im April die französische Präsidentschaftswahl statt, bei der wie bereits vor fünf Jahren wieder eine Menge auf dem Spiel steht. Die aktuellen Umfragen lassen eine Stichwahl zwischen Macron und Marine Le Pen (RN/ID) oder Valérie Pécresse (LR/EVP) erwarten; in beiden Fällen hätte Macron einen leichten Vorteil. Aber das Rennen ist sehr knapp – und angesichts der Schockwelle, die ein Wahlsieg Le Pens auslösen würde, wird es auch den Rest der EU in Atem halten.
Schicksalswahl in Ungarn
Aber Frankreich ist nicht das einzige Land, in dem 2022 eine Schicksalswahl ansteht. Im Frühling findet auch die ungarische Parlamentswahl statt, bei der sich in diesem Jahr alle relevanten Oppositionsparteien zusammengeschlossen haben, um mit gemeinsamen Kandidat:innen gegen die Regierung unter Viktor Orbán (Fidesz/–) anzutreten. Die Umfragen sehen einen sehr knappen Wahlausgang voraus.
Angesichts der eingeschränkten Medienfreiheit und der Nutzung staatlicher Mittel für Parteizwecke gelten Wahlen in Ungarn schon länger als „frei, aber nicht fair“. Und selbst bei einem Sieg der Opposition dürfte die Zusammenarbeit in dem heterogenen Bündnis, das linke, liberale und rechtskonservative Parteien umfasst, schwierig werden – auch weil viele unter Orbán erlassene Gesetze nur mit Zweidrittelmehrheit zu ändern sind. Dennoch ist es auf absehbare Zeit wohl die beste Chance für einen demokratischen Neuanfang. 2022 könnte für Ungarn die letzte Gelegenheit sein, das Ruder herumzureißen.
Weitere Wahlen
Darüber hinaus finden noch in einer Reihe weiterer EU-Mitgliedstaaten Wahlen statt. In Portugal und Malta haben die sozialdemokratischen Regierungen Anfang des Jahres gute Aussichten, ihre Mehrheit zu verteidigen. In Schweden wird es im Herbst eng zwischen der sozialdemokratischen Regierung und dem Mitte-rechts-Block unter Führung der Moderaterna (EVP), der erstmals auch für eine Zusammenarbeit mit den nationalistischen SD (EKR) offen ist.
In Slowenien tritt im April die nationalpopulistische Regierung um Janez Janša (SDS/EVP) zur Wiederwahl an; in dem zersplitterten und unruhigen slowenischen Parteiensystem scheint das Ergebnis völlig offen. In Lettland muss die 2018 gebildete, instabile Mitte-rechts-Koalition im Herbst ihre Mehrheit verteidigen; auch hier erschweren volatile Umfragen und eine Vielzahl kleiner Parteien an der Grenze der Fünf-Prozent-Hürde Prognosen für den Wahlausgang.
Halbzeit im Europäischen Parlament
Wenig Aufregung dürfte diesmal hingegen die Halbzeit der Wahlperiode im Europäischen Parlament bringen, die Anfang 2022 erreicht ist. Zu diesem Anlass werden traditionell wichtige Positionen neu besetzt, was vor fünf Jahren zu einer Kampfabstimmung um das Amt der Parlamentspräsident:in führte.
In diesem Jahr bahnte sich ein ähnliches Szenario an. Letztlich verzichtete Amtsinhaber David Sassoli (PD/SPE) jedoch auf eine aussichtslos erscheinende Neukandidatur und machte dadurch den Weg für Roberta Metsola (PN/EVP) frei – die erste Malteser:in in einer EU-Spitzenposition. Mit Kommissions- und Parlamentspräsidentin wird die EVP damit wieder zwei der EU-Topjobs besetzen, während sie im Europäischen Rat ihre dominierende Position verloren hat.
Klima und Migration
Aber natürlich wird 2022 nicht nur gewählt, sondern auch Politik gemacht. Zum Beispiel beim Klimaschutz: Das große Klimapaket „Fit for 55“, das die Kommission im Sommer 2021 vorgelegt hat, wird nun im Europäischen Parlament und im Rat verhandelt. Unter anderem geht es um die Überarbeitung des EU-Emissionshandelssystems, die Einführung einer CO2-Grenzausgleichsabgabe, die Reform der Erneuerbare-Energien-Richtlinie und die Einführung eines Klima-Sozialfonds. Der Streit um die Einstufung von Gas und Atomkraft als „nachhaltige“ Energiequellen dürfte nur der Auftakt für eine Reihe an klimapolitischen Auseinandersetzungen gewesen sein.
Ein anderes Thema, das im neuen Jahr erneut auf der Tagesordnung steht, ist die Asyl- und Migrationspolitik. Bereits 2020 hat die Kommission hierzu umfassende Reformvorschläge vorgelegt, doch aufgrund der weit auseinandergehenden Positionen der Mitgliedstaaten im Rat gab es seitdem keine Fortschritte in den Verhandlungen. Nach einer gemeinsamen Erklärung der EU-Institutionen zu den Gesetzgebungsprioritäten 2022 soll das Thema im neuen Jahr nun als „dringliche Angelegenheit“ behandelt werden.
Schengen-Reform
Auf der Agenda steht zudem eine Reform des Schengen-Systems. Dessen Schwächen haben sich in den letzten Jahren deutlich gezeigt: Einige Mitgliedstaaten – insbesondere Deutschland – führten während der Asylkrise 2015 „vorübergehende Grenzkontrollen“ ein, die sie seitdem durchgehend beibehalten haben. Und während der Corona-Pandemie kam es immer wieder zu einseitigen Reisebeschränkungen durch Mitgliedstaaten, die über das vom Rat empfohlene Maß hinausgingen.
Vor diesem Hintergrund hat die Kommission eine Reform vorgeschlagen, die den Spielraum einzelner Staaten bei der Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen reduzieren soll. Im Gegenzug soll die polizeiliche Zusammenarbeit in Grenzregionen intensiviert und auch der Schutz der Schengen-Außengrenzen stärker als eine gemeinsame EU-Angelegenheit behandelt werden. Die Vorschläge müssen nun zwischen Rat und Parlament verhandelt werden. Die Erfahrung früherer Schengen-Reformen lässt erwarten, dass es dabei einiges an Diskussionen geben wird.
Überarbeitung der EU-Defizitregeln
Und auch das fiskalpolitische Regelwerk der EU soll 2022 auf den Prüfstand kommen. In der Corona-Krise erwies sich die Lockerung von Defizitregeln und die Ausgabe europäischer Anleihen im Rahmen des Wiederaufbauinstruments Next Generation EU als wirksames Mittel gegen die Rezession. Zudem besteht ein wachsender Konsens darüber, dass Europa mehr Investitionen braucht – etwa für Infrastruktur, Digitalisierung, Klimaschutz.
Das hat eine neue Debatte über die Sinnhaftigkeit der EU-Defizitregeln ausgelöst, in der mit der deutschen und der niederländischen Regierung zuletzt auch zwei der wichtigsten fiskalpolitischen „Falken“ unter den Mitgliedstaaten eine gewisse Verhandlungsbereitschaft gezeigt (teils aber auch sofort wieder zurückgenommen) haben. Im ersten Quartal will die Kommission nun konkrete Vorschläge für eine Reform vorlegen.
Kampf um den Rechtsstaat
Auch der Konflikt um die Wahrung der europäischen Rechtsgemeinschaft und die gemeinsamen Werte der EU wird sich im neuen Jahr natürlich fortsetzen. Im Blickfeld steht dabei vor allem Polen, dessen regierungshöriges Verfassungsgericht 2021 nicht nur den Vorrang des Europarechts, sondern auch die Europäische Menschenrechtskonvention attackiert hat.
Umgekehrt hat der Europäische Gerichtshof jüngst ein Millionen-Zwangsgeld gegen Polen verhängt, um die Wiederherstellung einer unabhängigen Justiz zu erreichen. Im neuen Jahr werden für die EU weitere Instrumente hinzukommen: Zum einen sollen die Rechtsstaats-Länderberichte, die die Kommission seit 2020 jährlich herausgibt, künftig auch konkrete Empfehlungen an die Mitgliedstaaten enthalten.
Zum anderen dürfte der EuGH dann die Vertragskonformität des 2020 verabschiedeten Rechtsstaatsmechanismus bestätigen. Die Kommission hätte dann kein Grund mehr, diesen nicht einzusetzen; dass sie es nicht schon früher getan hat, brachte ihr im Oktober bereits eine Untätigkeitsklage des Europäischen Parlaments ein. Und auch die milliardenschweren Corona-Wiederaufbaupläne für Polen und Ungarn sind noch nicht bewilligt und könnten bei anhaltenden Rechtsstaatsverstößen weiter zurückgehalten werden.
Auch politisch steht die polnische Regierung zunehmend im Abseits – umso mehr, falls bei den anstehenden Wahlen in Ungarn und Slowenien ihre Verbündeten abgewählt werden sollten. Wirklich gelöst ist die Rechtsstaatskrise aber noch lange nicht. Sie bleibt die größte Gefahr für die Zukunft der Europäischen Union.
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
Auch in der Außen- und Sicherheitspolitik wird sich einiges tun – so viel, dass Ratspräsident Michel 2022 schon mal zum „Jahr der europäischen Verteidigung“ ausgerufen hat. Im März soll der neue Strategische Kompass verabschiedet werden, der die Grundlinien der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik definiert. Dabei soll auch gleich das Verhältnis zur NATO neu überdacht werden, die einige Monate später ihr neues Strategisches Konzept beschließen will.
Außerdem soll 2022 das „Global Gateway“ an Fahrt aufnehmen, ein globales Infrastruktur-Investitionsprogramm, das gemeinhin als Antwort der EU auf die chinesische „neue Seidenstraße“ verstanden wird. Im Februar 2022 soll außerdem endlich der seit zwei Jahren immer wieder verschobene Europa-Afrika-Gipfel stattfinden.
Europäisches Jahr der Jugend
2022 soll für Europa aber nicht nur ein Jahr der Verteidigung, sondern auch ein „europäisches Jahr der Jugend“ werden. Nachdem junge Menschen unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie besonders stark zu leiden hatten, wollen die Kommission und das Europäische Parlament sie nun ganz besonders in den Vordergrund stellen.
In der Praxis bedeutet das (neben vielen schönen Worten) insbesondere, dass die EU über Programme wie Erasmus+ ein Budget bereitstellt, aus dem dezentral organisierte Aktivitäten zur Jugendbeteiligung finanziert werden können. Außerdem startet in diesem Jahr das neue Programm ALMA, das die grenzüberschreitende Mobilität arbeitsloser junger Menschen fördern soll.
Die Zukunftskonferenz endet – beginnt der Verfassungskonvent?
Außerdem betonen die EU-Institutionen anlässlich des „Jugendjahrs“ gern, dass junge Menschen auch bei der Konferenz zur Zukunft Europas eine wichtige Rolle spielen. Die allerdings wird 2022 nach nur einem Jahr Laufzeit schon wieder enden. Nach dem Zeitplan der Konferenz stehen im Januar die letzten Treffen der Bürgerforen an. Anschließend wird die Plenarversammlung über die von den Foren vorgelegten Vorschläge diskutieren und Ergebnisse formulieren, auf deren Grundlage dann der Exekutivausschuss der Konferenz bis Mai einen Abschlussbericht erstellt.
Wie es danach weitergeht, ist unklar. Kommission, Parlament und Europäischer Rat haben zwar zugesichert, dass sie die Vorschläge der Konferenz aufgreifen werden. Wie das genau aussehen wird, muss sich aber erst noch zeigen. Einige Regierungen hätten wohl nichts dagegen, die Konferenz möglichst sang- und klanglos auslaufen zu lassen. Die neue deutsche Bundesregierung hat sich hingegen in ihrem Koalitionsvertrag darauf festgelegt, dass die Konferenz „in einen verfassungsgebenden Konvent münden“ sollte. Das Parlament wäre dazu sicher ebenfalls bereit. Man darf gespannt sein.
Wahlrechtsreform und Parteienreform
Über die Ausgestaltung der europäischen Demokratie wird allerdings nicht nur in der Konferenz diskutiert, sondern auch in den regulären Institutionen. Ende Januar steht im Verfassungsausschuss des Europäischen Parlaments eine Abstimmung über die EU-Wahlrechtsreform an, bei der es unter anderem um unterschiedliche Modelle gesamteuropäischer Listen geht. Parallel dazu hat die Kommission Ende November Vorschläge für eine Reform des europäischen Parteienrecht, des Unionsbürger-Kommunalwahlrechts sowie für die Regeln politischer Werbung gemacht, die 2022 von Parlament und Rat verhandelt werden.
Die Debatte über die Zukunft Europas ist in vollem Gang. Machen wir im neuen Jahr das Beste daraus!
Und nicht nur für die EU, auch für den Betreiber dieses Blogs geht das neue Jahr mit Veränderungen einher: Nach knapp drei Jahren am Institut für Europäische Politik in Berlin wechsle ich im Januar 2022 als Mitarbeiter an den Lehrstuhl für europäische Integration und Europapolitik der Universität Duisburg-Essen. Dieses Blog wird natürlich weiterhin die europapolitische Debatte begleiten – bleiben Sie dabei, es wird spannend. Erst einmal aber geht „Der (europäische) Föderalist“ in seine alljährliche Winterpause. Allen Leser:innen frohe Feiertage und ein glückliches und gesundes neues Jahr! |