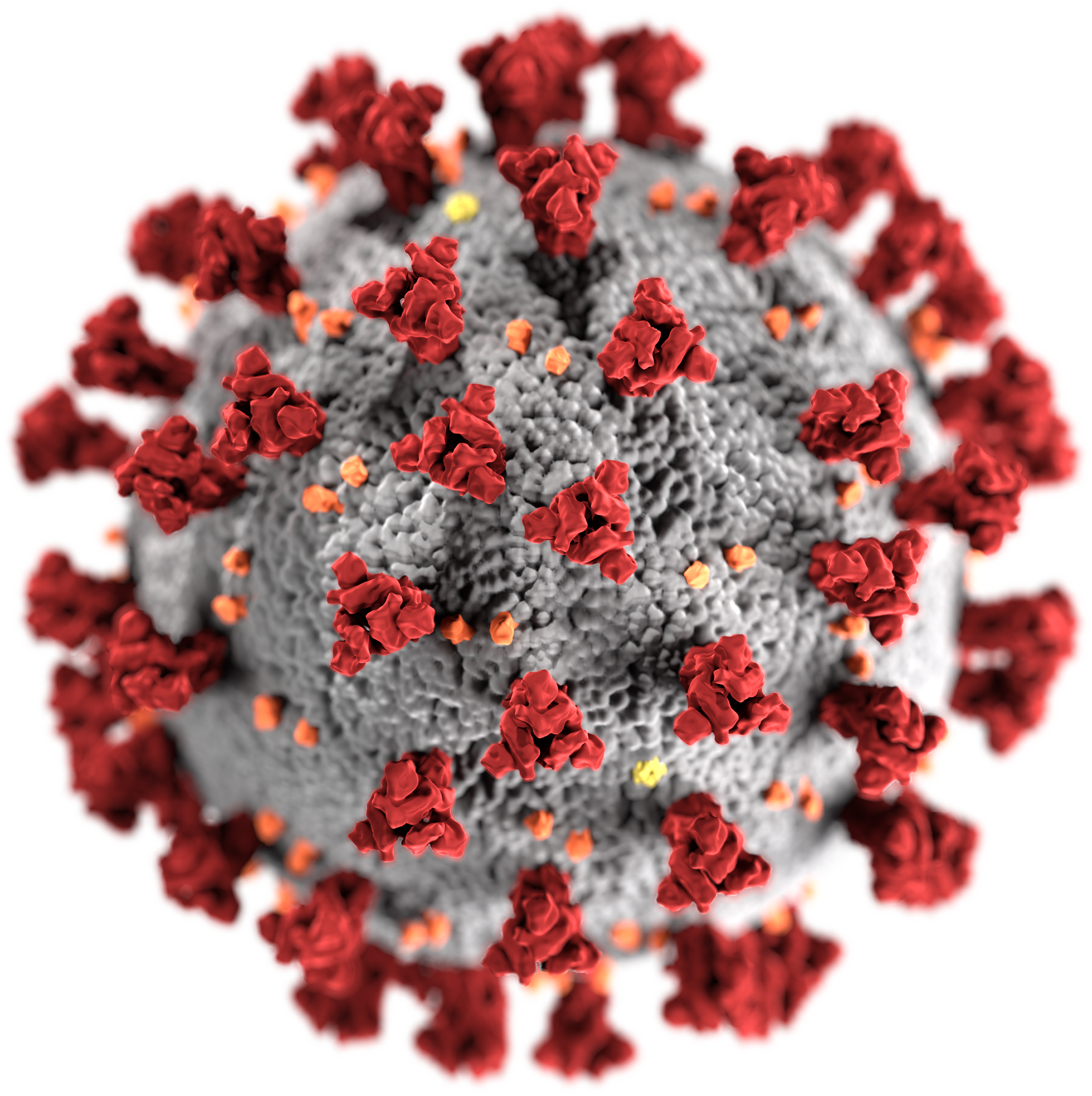Eigentlich
hätte es ein schönes Jubiläum sein können: Am gestrigen Donnerstag vor 25
Jahren trat
das Schengener Abkommen in Kraft, mit dem die Binnengrenzkontrollen
abgeschafft und das Reisen in der EU erleichtert wurde. Aber gerade sind die
Grenzen wieder zu, an Reisen ist nicht zu denken, und nach Feiern war den
Staats- und Regierungschefs bei ihrer Videokonferenz auch nicht zumute.
Stattdessen gab es eine
Menge Streit, wie die Kosten der Corona-Krise finanziert werden sollen, und
am Ende eine vage Einigung, sich in
zwei Wochen noch einmal mit dem Thema zu befassen. Das Coronavirus hat die
EU im Griff, und den Mitgliedstaaten fällt es – trotz aller Bekenntnisse zur
europäischen Solidarität – sichtlich schwer, ihre nationalen Reflexe abzulegen.
Wieder einmal Solidarität
Dass
es in der Krise vor allem auf die Mitgliedstaaten ankommt, ist den EU-Verträgen
geschuldet, die der Union im Bereich der öffentlichen Gesundheit (Art. 168 AEUV) nur recht begrenzte Kompetenzen einräumen. Die EU-Institutionen
können die Mitgliedstaaten in diesem Politikfeld koordinieren, sie unterstützen
und ihnen Empfehlungen geben, aber kaum Vorschriften machen. Und natürlich ist
auch der EU-Haushalt viel zu klein, als dass die Union aus eigener Kraft
nennenswerte Anstrengungen gegen die Krise unternehmen könnte.
Wie
so oft in den Krisen der letzten Jahre sind deshalb alle Augen auf den
Europäischen Rat gerichtet. Wieder einmal ist die Krise wenigstens teilweise
asymmetrisch und Südeuropa (wenigstens für den Moment) stärker betroffen als
der Norden. Und wieder einmal geht es vor allem darum, ob die nationalen
Regierungen bereit sind, einander beizustehen, oder ob in der Krise jedes Land
sich selbst am nächsten ist. Die bisherige Bilanz in diesem Ringen ist, im
besten Fall, durchwachsen – drei Beispiele.
Beispiel 1: Medizinische
Versorgung
Als
sich die Corona-Epidemie noch weitgehend auf China beschränkte, lieferten
EU-Mitgliedstaaten dorthin Mitte Februar Schutzkleidung,
Desinfektionsmittel und anderes medizinisches Material: Die Krankheit
wirkte weit entfernt, Unterstützung bei ihrer Bekämpfung eine humanitäre
Selbstverständlichkeit. Als wenig später die Krankheit auch in Italien
ausbrach, wurde die Schutzausrüstung hingegen schnell knapp – nicht zuletzt
aufgrund von Panikkäufen in der Bevölkerung. Bereits Ende Februar aktivierte die
italienische Regierung deshalb den EU-Katastrophenschutzmechanismus,
um um Hilfslieferungen zu bitten. Und auch die Kommission rief die
übrigen Mitgliedstaaten zur Unterstützung Italiens auf.
Doch
was in Wirklichkeit geschah, war genau das Gegenteil: Statt Italien zu helfen, verhängten
mehrere europäische Länder, die von der Krankheit selbst zwar noch kaum betroffen
waren, sich aber Sorgen wegen der Panikkäufe machten, Exportverbote
für medizinische Schutzkleidung. Die französische Regierung etwa
beschlagnahmte die vorhandenen Bestände an Atemschutzmasken und stellte sie nur
noch medizinischem Personal und Kranken in Frankreich zur Verfügung. In
Deutschland blieben, noch etwas absurder, Atemschutzmasken im freien Handel verfügbar
und damit auch ihre medizinisch weitgehend sinnlose Nutzung durch private
Gesunde möglich – aber eben nur innerhalb der Landesgrenzen.
Weniger
solidarisch als China?
Noch
hässlicher wirkte diese fehlende Hilfsbereitschaft durch den Kontrast mit China,
das sich nun für die europäische Unterstützung im Februar revanchierte und Italien
öffentlichkeitswirksam
Atemmasken lieferte. Obwohl diese Lieferungen gegen Bezahlung erfolgten
(also weniger humanitäre Hilfe als schlichte Warenexporte waren), stellten sie
im Kontext der innereuropäischen Exportverbote ein großer Imageerfolg für die
chinesische Regierung dar, die sich als
Helferin in der Not feiern lassen konnte, während die EU zutiefst
unsolidarisch erschien.
Erst
nach einem einen
eindringlichen öffentlichen Appell des italienischen EU-Botschafters und massiver
Kritik seitens der Kommission und der Benelux-Staaten lösten sich langsam
die innereuropäischen Blockaden. Mitte März entschied sich die deutsche
Bundesregierung zunächst für eine Lockerung
und schließlich Aufhebung
des Verbots für innereuropäische Exporte. Zugleich setzte sich Deutschland nun
mit Frankreich an die Spitze der Länder, die bilaterale medizinische
Hilfsmaßnahmen leisteten – sei es durch Lieferung
von medizinischen Gütern oder auch durch die Aufnahme
von Patienten aus den meistbetroffenen italienischen Regierungen.
Der
Katastrophenschutzmechanismus hilft – nach fast vier Wochen
Zugleich
lief auch auf EU-Ebene endlich die gemeinsame Beschaffung von Schutzausrüstung
im Rahmen des Katastrophenschutzmechanismus an. Am 24. März, fast vier Wochen nach
dem ersten italienischen Ersuchen, verkündete die Kommission, entsprechende
Lieferverträge könnten „in
Kürze unterzeichnet werden“.
Doch
auch in den letzten Tagen kam es noch zu Vorfällen, die das solidarische Bild
trüben: So stoppten polnische und tschechische Behörden vergangene Woche zwei chinesische
Lieferungen mit medizinischem Material für Italien, die italienische
Regierung selbst beschlagnahmte kurz darauf für
Griechenland bestimmte Beatmungsgeräte. Als eine Einheit agieren die
EU-Mitgliedstaaten bis heute nicht.
Beispiel 2:
Grenzschließungen
Dass
auch Einschränkungen der Bewegungsfreiheit nötig sind, um die Ausbreitung des
Virus zu bremsen, war frühzeitig Konsens. Dabei setzte die italienische
Regierung (ähnlich wie zuvor China) zunächst vor allem auf eine Abriegelung der
am stärksten betroffenen Gebiete. Als sich die Pandemie jedoch weiter
ausbreitete, verlegten sich Mitte März einige weniger betroffene Staaten vor allem im Norden und Osten
Europas auf eine umgekehrte Strategie: Sie schlossen einseitig die
nationalen Grenzen, um Virus draußen zu halten. Der Grenzverkehr für Personen
wurde drastisch reduziert, in vielen Fällen durften nur eigene Staatsbürger und
Menschen mit besonderen Genehmigungen noch einreisen.
Offiziell
begründet wurden diese Grenzschließungen oft mit der Notwendigkeit, Personenbewegungen
allgemein zu reduzieren, und mit der Behauptung, dass unterschiedlich strenge
nationale Regelungen (etwa bei Veranstaltungsverboten) dazu führen würden, dass
Menschen auf die andere Seite der Grenze auswichen. Unter Beobachtern stießen
die Grenzschließungen jedoch von Anfang an auf Kritik: Da das Virus Mitte März
bereits in allen EU-Staaten vorhanden war, spielte der zwischenstaatliche
Grenzverkehr für seine Ausbreitung keine so wichtige Rolle mehr, dass solch
drastische Maßnahmen gerechtfertigt wären.
Außengrenzen
werden schnell geschlossen, Binnengrenzen eher nicht
Besonders
befremdlich war dabei, dass auf vergleichbare Maßnahmen im Inland in der Regel verzichtet
wurde. So wurde etwa in Deutschland der innerstaatliche Reiseverkehr zwar dadurch
erschwert, dass touristische
Hotelübernachtungen und Reisebusfahrten verboten wurden – eine Ein- und
Ausreise aus dem Ort Heinsberg, wo es besonders viele Infizierte gab, wurde
jedoch zu keinem Zeitpunkt verhindert.
Warum
also waren die Staaten viel eher bereit, die nationalen Außengrenzen zu
schließen als innerstaatlich Territorien abzuriegeln? Letztlich dürften
dahinter praktische und politische Machbarkeitserwägungen gestanden haben: Innerstaatliche
Grenzen zu schließen, um Reiseverkehr zu verringern, ist aufgrund der fehlenden
Infrastruktur nur schwer umzusetzen. An zwischenstaatlichen Grenzen hingegen
ist die kurzfristige Wiedereinführung von Grenzkontrollen auch durch die Schengen-Verordnung
immer als Option erhalten geblieben und wirkt auch im öffentlichen Bewusstsein als
ein viel normalerer Vorgang (umso mehr, als nationale Grenzschließungen ja
zunächst einmal immer nur die Staatsbürger der anderen Länder einschränken, nicht die eigenen).
Auch die EU
schließt ihre Außengrenzen
Der
EU-Kommission blieb bei all dem nur, die einzelnen Mitgliedstaaten zu einem
koordinierten Vorgehen zu ermahnen und ihnen mäßigende Leitlinien
für coronabedingte Grenzmaßnahmen an die Hand zu geben. Was indessen den
Rest der Welt betrifft, reagierte die EU gar nicht so anders als ihre Mitgliedstaaten:
Mitte März verhängte sie strikte
Einreisekontrollen für Nicht-EU-Bürger, obwohl eine ähnliche Maßnahme der
USA eine Woche zuvor in
Brüssel noch auf bittere Kritik gestoßen war.
Insgesamt
zeigten damit die Mitgliedstaaten und die Union ein ähnliches Bild: Wer die
Macht hat, eine Außengrenze zu schließen, der neigt in der Krise dazu, das auch
zu tun – oft mit sehr viel größerer Bereitschaft, als wenn es um das Abriegeln besonders betroffener Gebiete im eigenen Landesinneren geht.
Beispiel 3: Finanzielle
Maßnahmen
Der
größte Streit der letzten Tage schließlich betrifft die finanziellen Maßnahmen
zur Bekämpfung der absehbaren Wirtschaftskrise. Angesichts der massiven
Einschränkungen des öffentlichen Lebens ist eine schwere Rezession in den
nächsten Monaten wohl unvermeidbar; viele Akteure (von großen
Flugunternehmen bis zu kleinen
Selbstständigen) bangen um ihr wirtschaftliches Überleben und sind auf
staatliche Unterstützung angewiesen. Wie aber soll diese Unterstützung finanziert
werden?
Als
erste Maßnahme schlug die Europäische Kommission am 20. März die
Aktivierung der „allgemeinen Ausweichklausel“ vor, um die Defizitregeln des
Stabilitätspakts auszusetzen. Als Folge dürften die nationalen Regierungen
unbegrenzt Schulden aufnehmen, um die Coronakrise zu bekämpfen. Das allein
dürfte allerdings noch zu wenig sein: Wenn jeder Mitgliedstaat nur für sich
allein verantwortlich ist, könnte das Ausmaß der Krise viele von ihnen
überfordern. Und wenn dann auf den Finanzmärkten Zweifel an ihrer Bonität
entstehen, droht im schlimmsten Fall eine neue Staatsschuldenkrise wie in den
Jahren ab 2010.
„Coronabonds“ und
ESM-Kredite
Bereits
Mitte März schlug der italienische Regierungschef Giuseppe Conte (parteilos)
deshalb die
Einführung von „Coronabonds“ vor: gemeinschaftlichen Anleihen der
EU-Mitgliedstaaten, aus denen Maßnahmen gegen die Krise finanziert werden
sollten. Der Vorschlag erinnert stark an die Eurobonds, die während der Eurokrise
diskutiert wurden, und auch die Konfliktlinien zwischen den nationalen
Regierungen sind die gleichen wie damals: Neun hauptsächlich südeuropäische Staats-
und Regierungschefs (aus Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland
und Slowenien, aber auch Belgien, Luxemburg und Irland) unterstützten die Idee am
vergangenen Mittwoch in
einem gemeinsamen Schreiben.
Deutschland
und die Niederlande lehnen den Vorschlag hingegen ab. Der niederländische
Finanzminister Wopke Hoekstra (CDA/EVP) warnte gar in
bester Eurokrisenrhetorik, Coronabonds würden die „strukturellen
Herausforderungen“ der Mitgliedstaaten nicht lösen und „Anreize für eine
umsichtige Politik auf nationaler Ebene untergraben“. Wie schon die Eurobonds
könnten also auch die Coronabonds am deutsch-niederländischen Widerstand scheitern.
Die
plausibelste Alternative zu ihnen wären Hilfskredite aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus,
doch auch
darüber gibt es Streit: Während die südeuropäischen Länder sich dafür
einsetzen, dass der ESM in dieser Situation bedingungslos Unterstützung leistet,
wollen Deutschland und verschiedene nordeuropäische Länder am Prinzip
festhalten, dass ESM-Kredite grundsätzlich nur gegen Auflagen möglich sind. Der
niederländische Premierminister Mark Rutte (VVD/ALDE) erklärte zudem, für
einen Einsatz des ESM sei es ohnehin noch „zu früh“. Die Entscheidung wurde
jedenfalls erst einmal verschoben.
Während der Europäische
Rat streitet, wird die EZB aktiv
Kommt
es also zur Eurokrise 2.0? Einige Umstände geben immerhin Hoffnung, dass die
Staatsschuldenfrage diesmal nicht ganz so dramatisch ausfallen wird wie in den Jahren
nach 2010. Zum einen hat sich insbesondere in Deutschland auch der öffentliche
Diskurs weiterentwickelt: Während in der deutschen Öffentlichkeit während der
Eurokrise vor
allem Ökonomen sichtbar waren, die Unterstützung für andere EU-Länder ablehnten,
veröffentlichte jüngst sogar die konservative FAZ einen Gastbeitrag
einer Gruppe deutscher Wirtschaftswissenschaftler, die sich für Coronabonds
aussprachen. Zum anderen hilft auch schlicht die Tatsache, dass es den ESM
bereits gibt und dass er grundsätzlich einsatzfähig ist. Worum es geht, ist
nicht mehr das Ob, sondern das Wie von zwischenstaatlichen Hilfen.
Dennoch:
Erst einmal hat sich der Europäische Rat in dieser Frage so zerstritten, dass
in den nächsten zwei Wochen mit überhaupt keine Entscheidung gerechnet werden
kann. In der Zwischenzeit bleibt wie in der Eurokrise nur die Europäische Zentralbank
als Akteur übrig, um mit
einem gewaltigen Aufkaufprogramm gegen die Corona-Krise vorzugehen. (Dabei hatte
EZB-Chefin Christine Lagarde nur eine Woche zuvor noch die Regierungschefs
aufgerufen, doch bitte selbst
aktiv zu werden und diese Angelegenheit nicht der Zentralbank zu überlassen.
Aber auch diese Dynamik ist noch aus der
Eurokrise vertraut.)
Fazit
Betrachtet
man all diese Beispiele zusammen, so lässt sich daraus eine allgemeine Lehre ziehen:
Wenn es hart auf hart kommt, hängt das Ausmaß an europäischer Solidarität
wesentlich davon ab, ob es für den Umgang mit der Krise gemeinsame
Institutionen mit echten Kompetenzen gibt.
Wo
europäische Institutionen fest etabliert sind und eigene Entscheidungen treffen
können, suchen sie wie die EZB nach Möglichkeiten, in der Krise im gemeinsamen europäischen
Interesse zu handeln. Wo Institutionen vom guten Willen der nationalen
Regierungen abhängig sind, reagieren sie wie der Katastrophenschutzmechanismus
oder der ESM nur mit Verzögerung und nach großem Streit. Und wo Institutionen zum Rückzug ins Nationale einladen, werden sie wie die nationale Kompetenz zur vorübergehenden
Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen trotz aller schönen Worte genutzt.
Es
wäre sicher falsch, die grundsätzliche europäische Solidaritätsbereitschaft der
EU-Mitgliedstaaten in Zweifel zu ziehen. Aber damit sie in Krisensituationen in
schnelles Handeln umgesetzt werden kann, ist es besser, sich nicht auf „gemeinsame
Werte“ und dergleichen zu verlassen, sondern auf starke supranationale
Institutionen.
Bild: CDC / Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM [Public domain], via Wikimedia Commons.